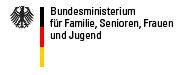25. AKF-Jahrestagung 2018: Die Freiheit des So-Seins – Arbeitskreis Frauengesundheit 1993–2018
Die Jubiläumstagung des AKF am 3./4. November 2018 im Deutschen Hygienemuseum in Dresden

Frauengesundheitsbewegung in Aktion: Die AKF Jahrestagung 2018 in Dresden, Bildnachweis: © AKF e.V.
Tagungsprogramm:
Einführung ins Tagungsthema
Zum 25. Jahrestag seiner Gründung wird der AKF den Wandel im Feld der Frauengesundheit 1993 bis 2018 in Medizin und Gesellschaft reflektieren. Haben sich die medizinischen und gesellschaftlichen Bedingungen für Frauen in diesen Handlungsfeldern verbessert oder nicht? Die Antworten fallen unterschiedlich aus. Einerseits sind gravierende Missstände wie die hohe Zahl medizinisch nicht indizierter Gebärmutterentfernungen geringer geworden. Die Schulmedizin hat sich den Sichtweisen der Frauengesundheitsbewegung gegenüber geöffnet. Lesbische Lebensweisen, Migration und Rassismus, häusliche und sexualisierte Gewalt mit ihren Auswirkungen auf Gesundheit werden häufiger thematisiert. Höhere Aufmerksamkeit erfahren die Diskussionen um gesundheitliche Selbstbestimmung und verständliche Patientinneninformation. Dennoch bleibt viel zu tun.
Es gibt auch gegenläufige Tendenzen und neue Herausforderungen für die Frauengesundheitsbewegung. Vor dem Hintergrund eines gleichzeitig verstärkten Wertekonservatismus sind Information über und die praktische Umsetzung des erkämpften Rechts auf Abtreibung bei ungewollter Schwangerschaft gefährdet. Die gesellschaftlichen Erwartungen an Schönheit, Gesundheit und individuelles Präventionsverhalten steigen – die Kommerzialisierung des Gesundheitswesens nimmt zu. Das führt zu fast grenzenlosen Angeboten und Nachfragen, von der Schönheitschirurgie oder Reproduktionsmedizin, über die pränatale Diagnostik bis zur digitalen Selbst- und Fremdüberwachung des Frauenkörpers. All das hat erhebliche gesellschaftliche und individuelle Auswirkungen auf die Selbstwahrnehmung von Frauen, das gesellschaftliche Zusammenleben sowie Erwartungen an die Medizin.
Wir möchten auf dieser Tagung deutlich machen, was erkämpft wurde, was verteidigungswürdig ist, und mit welchen neuen und alten Fragestellungen und Themen wir uns aktuell und zukünftig auseinandersetzen müssen.
9.15–9.30 Uhr: BegrüßungVorsitzende des AKF e. V. Prof. Dr. Ingrid Mühlhauser und Grußworte aus der Politik
9.30–11.15 Uhr: DIALOGE MIT DISKUSSION: Frauengesundheit in Politik und Praxis zwischen 1993 und 2018
Moderation: Dr. Eva Schindele, Referentinnen: Dr. Claudia Czerwinski (AKF Gründungsvorstand) und Prof. Dr. Beate Schücking (AKF Gründungsvorstand), Dr. Viola Hellmann (Frauenärztin, eine der ersten AKF Mitgliedsfrauen aus den neuen Bundesländern) und Teilnehmerinnen der Tagung
Abstract und Audio
Als der AKF vor 25 Jahren gegründet wurde, galt die Gebärmutter als unnützes Organ, zumindest dann, wenn die Frau keinen Kinderwunsch hatte. Jeder zweiten Frau wurde in den Wechseljahren die Gebärmutter oft zusammen mit den Eierstöcken entfernt – für viele verbunden mit schwerwiegenden Folgen. Männliche Gynäkologen besaßen damals das Monopol über den weiblichen Körper. Heute gibt es zwar viel mehr weibliche Frauenärzte und die Gesundheitsforschung und -versorgung ist gendersensibler – aber hat sich deshalb die Situation für die Frauen grundlegend verbessert? Oder hat dies der Medikalisierung des Weiblichen nur weiter Vorschub geleistet? Zu beobachten ist zumindest eine zunehmende Kommerzialisierung der Frauengesundheit verbunden mit der Botschaft, dass Frauen sich vorsorglich ab der Pubertät regelmäßig medizinisch durchchecken lassen sollen. Andererseits werden psychische Probleme, oft aufgrund häuslicher und sexualisierter Gewalt, dank der Frauenbewegung heute auch von Professionellen mehr wahrgenommen. Sind wir damit zufrieden? Und wie haben sich die Erwartungen der Patientinnen an die Gynäkologie verändert? Darüber wollen wir mit den Gründerinnen des AKFs, Dr. Claudia Czerwinski und Prof. Dr. Beate Schücking ebenso sprechen wie mit der Dresdner Frauenärztin Dr. Viola Hellmann und natürlich mit den Teilnehmerinnen der Tagung.
Zum Nachhören:
11.45–13.00 Uhr VORTRAG MIT DISKUSSION
Wie viel medizinische Sorge braucht weibliche Gesundheit?
Prof. Dr. Ingrid Mühlhauser, Ärztin und AKF Vorsitzende, Hamburg
Abstract
Mit 9 Jahren gegen HPV Infektionen geimpft, mit 15 Initiationsritus durch kollektive Verabreichung der „Pille“, jährlicher ärztlicher „TÜV“ der äußeren und inneren Geschlechtsteile, strategische medizinische Planung und Überwachung der Schwangerschaft, Mammografie-Screening, Sexual- und Schilddrüsenhormone gegen die Bürden des Alltags und Anti-Age, Check-ups bis ins Seniorenalter auf Osteoporose, Demenz und Depression. Fast die Hälfte der Pflegeheimbewohnerinnen werden mit Psychopharmaka ruhiggestellt. Die wenigsten medizinischen (Vor-)Sorge-Maßnahmen sind wissenschaftlich gerechtfertigt. Der Schaden ist erheblich. Der massiven medizinischen Überversorgung von Gesunden steht eine sträfliche Vernachlässigung von Frauen gegenüber, die Sorge am dringendsten benötigen: rund um die Geburt, bei Gewalterfahrung und Ausgrenzung, Hilflosigkeit im Alter oder Überlastung alleinerziehender Mütter, die verarmen. Armut bedeutet Krankheit. Der Unterschied in der Lebenserwartung zwischen der oberen und der unteren sozialen Schicht beträgt acht Jahre. Im Vergleich dazu: durch ein bevölkerungsweites Mammographie-Screening lässt sich ein Überlebensvorteil für Frauen nicht nachweisen. Frauengesundheit braucht weniger Geschäft, weniger Herrschaft und mehr soziale Gerechtigkeit.
15.00–17.00 Uhr: THEMENCAFÉ – Frauengesundheit in Praxis, Politik und Gesellschaft auf dem Prüfstand – was ist zu tun?
THEMENAREAL 1: Schwangerschaftsabbruch und sexuelle Selbstbestimmung heute – die Forderung zur Abschaffung des § 219a und die Umsetzung von Informationsfreiheit und freier Ärzt_innenwahl
Input: Dr. Antje Huster-Sinemillioglu, Gynäkologin
Abstract
Selbstbestimmung setzt voraus, dass frau keinen Zwängen unterliegt, freien Zugang zu Informationen hat, diese verstehen, für sich auswerten und schlussendlich auf sich beziehen kann. Beim Thema Schwangerschaftsabbruch hat die Frau in der Konfliktsituation keinen freien Zugang zu Informationen. Zudem ist die Beratung für sie bei einer Schwangerschaftskonfliktberatungsstelle nicht freiwillig, sondern „Pflicht“, sonst begehen die durchführenden Ärzt_innen eine Straftat, falls ein Abbruch durchgeführt wird. Aus dem therapeutischen Setting ist bekannt, dass eine Beratung unter Zwang nur wenig effektiv sein kann. Ärzt_innen unterliegen dem § 219a des Strafgesetzbuches und dürfen nicht öffentlich darüber informieren, dass sie Schwangerschaftsabbrüche durchführen, ohne mit massiven Repressionen, bzw. einer Verurteilung rechnen zu müssen. Die Selbstbestimmung bleibt dabei für beide Seiten auf der Strecke.
Im Themencafé sollen Barrieren im Medizinsystem anhand der Regelung für Schwangerschaftsabbrüche aufgezeigt und Vorschläge zu deren Überwindung erarbeitet werden.
THEMENAREAL 2: Sexismus, Gewalt und Trauma: Immer noch Sexualobjekt? #metoo, teendating violence – welche politischen Forderungen erheben wir?
Input: Cony Lohmeier, Diplompsychologin/klinische Psychologin
Abstract
Sexismus hat neue Ausdrucksformen gefunden – auch geprägt durch das Internet und soziale Netzwerke. Parallelen wie Veränderungen im zeitgeschichtlichen Kontext der letzten 50 Jahre werden thematisiert. Dabei wird besonders auf die Machtaspekte von sexualisierter Gewalt und Übergriffigkeit eingegangen. Es wird in der Moderation Raum gegeben für die Entwicklung weiterer politischer Forderungen.
THEMENAREAL 3: (Intersektionale) Diskriminierungserfahrungen von Frauen* in Medizin, Psychotherapie und Gesellschaft – gesellschaftliche und politische Forderungen
Input: Diana Crăciun, Master Gender & Diversity
Abstract
Im Input wird es um die Definition von Diskriminierung und Intersektionalität sowie um Auswirkungen von Diskriminierungen auf mehreren Ebenen gehen. Bezugnehmend auf die Erfahrungen der Teilnehmenden sollen gemeinsam Konzepte und Aktivitäten gegen Diskriminierungen diskutiert, Best Praxis Modelle vorgestellt und (neue) Konzepte erörtert werden.
THEMENAREAL 4: Medikalisierung körperlichen Lebensphasen am Beispiel Verhütung, Geburt, den Wechseljahren, Alter, Tod
Input: Juliane Beck, Gesundheitsaktivistin
Abstract
Deutschland ist europaweit führend bei der Pathologisierung der Schwangerschaft (mit einer hohen Zahl an pränataldiagnostischen Untersuchungen). Die Geburtshilfe ist in vielen Kliniken von einer Kaiserschnittrate von 40 % geprägt. Der Berufsverband der Frauenärzte versucht gerade, die Hormonersatztherapie in den Wechseljahren wieder salonfähig zu machen, die seit den Veröffentlichungen der Studien der Women´s Health Initiative 1993 stark rückläufig war. Altern wird immer weniger als ein normaler Prozess angesehen; festzustellen ist ein sozialer Druck zum Jung- und Fitbleiben. Forschung zum Aufhalten des Alterungsprozesses bekommt maximale mediale Aufmerksamkeit. Der Tod findet fast immer noch im Krankenhaus oder Pflegeheim statt, wesentlich seltener in Hospizen und zu Hause. Optimierungswünsche können in nicht beabsichtigte Handlungszwänge führen. Sich selbst und den eigenen Körper anerkennen, den eigenen (Zu-)Stand genau benennen ist eine gute Voraussetzung für innere und äußere Freiheit und Entscheidungsfindung. Was unterstützt, was behindert Frauen auf dem Weg zur Selbstbestimmung?
THEMENAREAL 5: Der Anspruch auf Optimierung des Körpers: Selbstdisziplinierung und Normierung durch „Gesundheitsselbstsorge“, Gesundheits-Apps, Sport und Schönheitsoperationen
Input: Erika Feyerabend, Sozialwissenschaftlerin
Abstract
Körperliche und psychische Grenzen zu überwinden oder sie zu akzeptieren ist heute ein dauerhafter Balanceakt – besonders für Frauen. Ob Schönheitschirurgie oder Reproduktionsmedizin, digitale Selbstüberwachung des Körpers, die Angebote sich selbst zu optimieren sind grenzenlos und unabschließbar. Mittlerweile werden die sozialen Positionen/Karrieren, einmal mehr die Chancen auf einem – mittlerweile digitalen – “Beziehungsmarkt” am optimierten Körper organisiert. Der US-amerikanische Soziologe Antony Giddens nennt das Phänomen, den Körper zu einem zentralen Objekt der Gestaltung zu machen, das „reflexive Projekt der Selbstidentität“.
Die gesellschaftlichen Bedingungen und Folgen dieses Phänomens sind Thema dieser Abteilung des Themencafés.
THEMENAREAL 6: Offen für alle Teilnehmerinnen, die nach dem Rundgang zu den Themenarealen „auch noch woanders hin denken“: Welche weiteren Schwerpunkte soll die Frauengesundheitsbewegung zukünftig setzen?
Moderation: Isabel Schindele, Sozialpädagogin/Kulturpsychologin
Download Dokumentation: Berichte und Ergebnisse des Themencafés (pdf)
17.00–19.00 Uhr FÜHRUNG IN GRUPPEN DURCH DIE AUSSTELLUNG IM DEUTSCHEN HYGIENEMUSEUM DRESDEN: RASSISMUS. DIE ERFINDUNG DER MENSCHENRASSEN
Sonntag, 4.11.2018 (Tagesmoderation: Erika Feyerabend)
ab 8.30 Uhr Einlass und Anmeldung
9.30–10.45 Uhr: VORTRAG
Geschichte und Wahrnehmungen von Weiblichkeit
Prof. Dr. Christina von Braun, Kulturtheoretikerin und Filmemacherin, Berlin
Abstract
Sexualität und geschlechtlicher Körper gelten gerne als ‚naturgegeben‘. In Wirklichkeit handelt es sich jedoch um historische wandelbare Gegebenheiten – für den homo sapiens allemal. Aber sogar die Evolutionsforschung räumt inzwischen ein, dass ihr Blick auf die angebliche ‚Natur‘ von Tieren und Primaten von einer Sicht getrübt war, die als Rückprojektion von Wunschbildern zu umschreiben ist: Es ging um eine ‚Frau‘, die es nie gegeben hat, so die Erkenntnis einer bekannten Evolutionsanthropologin.
Die Wahrnehmung des männlichen und weiblichen Körpers wie auch das Verhältnis der Geschlechter haben in den letzten zweihundert Jahren einen radikalen Wandel erfahren, der sich nicht nur im Aufkommen einer neuen Geschlechterordnung, der Zulassung von Frauen zu akademischer Bildung, politischer Macht, ökonomischer Autonomie, sondern auch in der Entkriminalisierung der Homosexualität und dem Aufkommen neuer Familienkonstellationen niederschlug. Dabei wurde zunehmend evident, dass die angeblichen ‚Fakten der Natur‘ zum Gutteil auf Wunschbildern beruhten, die soziale und biologische Realitäten geschaffen hatten. Als diese ‚Fakten in den letzten zweihundert Jahren – mit mentalitätsgeschichtlich einmaliger Geschwindigkeit – ihre Glaubwürdigkeit einbüßten, wurde offenbar, dass es sich immer schon um kulturelle Zuweisungen an den weiblichen und männlichen Körper gehandelt hatte. In dem Vortrag sollen einige der historischen Hintergründe, die zum Umbruch führten, dargestellt werden – ein Umbruch, der sowohl die soziale Realität als auch das naturwissenschaftliche Denken verändert hat und zu einer neuen Einschätzung des Verhältnisses von Natur und Kultur führte.
10.45–11.30 Uhr: VORTRAG
Weibliches und Männliches rund ums Essen
Prof. Dr. Eva Barlösius, Soziologin, Hannover
Abstract
Es gehört zu den alltäglichen, aber auch wissenschaftlichen Evidenzen, dass sich Frauen und Männer bezüglich ihrer Ernährung, ihres Körperbildes, ihres Kochstils und selbst bei der Ausübung von Ernährungsberufen unterscheiden. Die Welt des Essens scheint in eine weibliche und eine männliche Welt zu zerfallen. Dafür gibt es viele Hinweise und Belege; so geben beispielsweise mehr Frauen als Männer an, regelmäßig auf ihr Gewicht zu achten und ihre Ernährung nach gesundheitlichen Gesichtspunkten auszurichten. Andererseits unterscheiden sich die beiden Geschlechter nur wenig bezüglich ihres Übergewichts und der ernährungsphysiologischen Zusammensetzung ihrer Nahrung. Wie erklärt sich dieser vermeintliche Widerspruch? Mit dieser Frage befasst sich Eva Barlösius.
12.00–14.00 Uhr PODIUMSDISKUSSION
Frauengesundheit in 25 Jahren – was lief gut – was lief schief – wo läuft’s hin? Ambivalenzen feministischer Gesundheitspolitik
Moderation: Margit Glasow, Journalistin, Berlin
Es diskutieren:
Ute Brutzki, Historikerin/Germanistin, Bereichsleiterin Genderpolitik bei ver.di
Mit dem Schwerpunkt: Frauen auf dem Arbeitsmarkt, Vereinbarkeit von Familie/Pflege und Beruf.
Prof. Dr. Ingrid Schneider, Politologin, Hamburg
Ihr Fokus: Selbstbestimmung im Kontext von Abtreibung, pränataler Diagnostik/Reproduktionsmedizin sowie dem Einsatz von Informationstechnologien in der Medizin.
Aliaa AlMustafa, Projektkoordinatorin bei DaMigra/MUT-Projekt Leipzig
Das Thema: Diskriminierungserfahrungen von Frauen in verschiedenen sozialen Kontexten und die Auswirkungen auf ihre psychische Gesundheit.
Dr. Eva Waldschütz, Frauenärztin, Gruiten
Ihre Aufmerksamkeit richtet sich vor allem auf die Abtreibungspolitik und die reproduktivmedizinischen Angebote in der frauenärztlichen Praxis.
Zum Abschlusspodium
Das Abschlusspodium nimmt die Ambivalenzen feministischer Gesundheitspolitik im Laufe der vergangenen 25 Jahre in den Blick. „Selbstbestimmung“ war und ist ein zentraler Begriff in der Frauengesundheitsbewegung. Sind dessen frühere Bedeutungen, die sich mit einer kollektiven, frauenpolitischen Abwehr staatlicher Eingriffe in private Entscheidungen wie Abtreibung, Fruchtbarkeit und Kinderkriegen verbanden, auch heute zu bedenken? Wird „Das Private noch politisch“ verstanden, wenn Entscheidungen für beispielsweise pränatale, reproduktionsmedizinische, digitale und selbstüberwachende oder schönheitschirurgische Angebote als rein individuelle, selbstbestimmte Wahl verstanden wird? Ist der gängige Slogan „vom Wert der Vielfalt“ im gesellschaftlichen Zusammenleben ein Fortschritt – oder werden so alte und neue Diskriminierungspraktiken verdeckt? Wie haben sich die Inhalte feministischer Kritik am Verhältnis von „produktiver“ und „reproduktiver Arbeit“ gewandelt?
14.00–14.30 Uhr: Abschluss der 25. Jahrestagung mit Erklärung des AKF zur Tagung und Ausblick
Prof. Dr. Ingrid Mühlhauser
An der Konzeption und Vorbereitung der AKF-Jahrestagung 2018 haben mitgewirkt:
Juliane Beck, Karin Bergdoll, Erika Feyerabend, Dr. Viola Hellmann, Dr. Dagmar Hertle, Prof. Dr. Ingrid Mühlhauser, Ellen Ohlen-Wallenhorst, Dr. habil. Viola Schubert-Lehnhardt.
Referentinnenverzeichnis
Namen und Tätigkeitsbereiche der Referentinnen, Workshop-Leiterinnen und Moderatorinnen
Aliaa AlMustafa
ist Projektkoordinatorin des DaMigra/MUT-Projektes in Leipzig. Sie arbeitet als Forscherin und Autorin zu Fragen von Frauen und Kindern sowie als Trainerin für internationale Mechanismen zum Schutz der Menschenrechte.
Prof. Dr. Eva Barlösius
forscht an der Leibniz Universität Hannover im Bereich Makrosoziologie und Sozialstrukturanalyse. Sie ist Gründungsmitglied des interdisziplinären Arbeitskreises „Kulturthema Essen“ und hat viel veröffentlicht, u. a.: Soziologie des Essens : Eine sozial- und kulturwissenschaftliche Einführung in die Ernährungsforschung, 2. Auflage, Juventa-Verlag, Weinheim/München 2011, sowie Dicksein. Wenn der Körper das Verhältnis zur Gesellschaft bestimmt. Campus, Frankfurt am Main 2014.
Juliane Beck
ist Gesundheitsaktivistin (Schwerpunkt: Versorgung rund um die Geburt), Rechtsanwältin, Coach, Ehe-/Lebensberaterin, ehem. Geburtsvorbereiterin. Seit November 2017 Mitglied des geschäftsführenden Vorstands des AKF. Zudem ist sie Vorstand der Planungsgruppe Frauengesundheitskonzepte e.V. München. Sie leitet den „Runden Tisch Lebensphase Elternwerden“ im AKF. Die Stärkung der Selbstbestimmung von Frauen bezüglich ihres Körpers ist ihr ein zentrales Anliegen. Sie hat das erste Buch mit Geburtsberichten von Eltern in deutscher Sprache herausgegeben (Erlebnis Geburt, München 1982) sowie Artikel zur kommunalen Hebammenversorgung und zu PatientInnenrechten veröffentlicht. Sie ist AKF-Mitglied seit 1996, weil sie dort stets wichtige Anregungen und Netzwerkpartnerinnen gefunden hat.
Prof. Dr. Christina von Braun
ist Kulturtheoretikerin, Autorin und Filmemacherin, Professorin i.R. für Kulturwissenschaft an der Humboldt-Universität zu Berlin. Sie ist auch Gründungsleiterin und jetzt Ko-Direktorin des 2012 eingerichteten Selma Stern Zentrums für Jüdische Studien Berlin-Brandenburg. Christina von Braun hat über fünfzig Filmdokumentationen, zahlreiche Bücher und Aufsätze zur Medien-, Kultur- und Mentalitätsgeschichte veröffentlicht. Sie ist Mitgründerin und langjährige Leiterin des Studiengangs Gender Studies an der Humboldt-Universität zu Berlin. Sigmund Freud Kulturpreis 2013. Zu den neueren Publikationen gehören: Christina von Braun, Blutsbande. Verwandtschaft als Kulturgeschichte, Berlin (Aufbau) 2018; Christina von Braun, Bettina Mathes, Verschleierte Wirklichkeit. Die Frau, der Islam und der Westen, Gießen (Psychosozial) 2017; Christina von Braun, Versuch über den Schwindel. Religion, Schrift, Bild, Geschlecht, Gießen (Psychosozial) 2016; Christina von Braun, Der Preis des Geldes. Eine Kulturgeschichte, Berlin (Aufbau) 2012. Homepage: www.christinavonbraun.de.
Ute Brutzi
Ist Historikerin und Germanistin. Aktuell hat sie die Bereichsleitung Genderpolitik bei der Dienstleistungsgewerkschaft ver.di inne. Ihre Arbeitsschwerpunkte Mitbestimmung im Betrieb und in Aufsichtsgremien, Familienpolitik – insbesondere die Vereinbarkeit von Familie/Pflege und Beruf sowie geschlechtergerechte Digitalisierung in der Arbeitswelt.
Diana Crăciun
Als M.A. Gender & Diversity engagiert sich Diana Crāciun seit mehr als 8 Jahren u.a. in der Sensibilisierung zum Thema Vielfalt in einer globalisierten Welt sowie im Umgang damit und die dafür nötigen Strukturen in unterschiedlichen Kontexten. Für Gesundheit an der Schnittstelle zu Antidiskriminierung ergeben sich für sie im Kontext Deutschland verschiedene Tätigkeitsschwerpunkte: sexuelle Gesundheit und sexuelle Rechte sowie reproduktive Gerechtigkeit. Ihre Funktionen als ehemals Diversity- und Öffentlichkeitsbeauftragte in einem Familienplanungszentrum und aktuell Projektkoordination in der Deutschen AIDS-Hilfe zu Themen wie Partizipation und Suchthilfe verleihen ihr einen scharfen Blick auf die benannten Themen – auch auf die Zusammenhänge dazwischen.
Dr. Barbara Ehret
Barbara Ehret, Frauenärztin und gemeinsam mit Ingrid Olbricht Initiatorin der Gründung des AKF im November 1993. Sie war langjähriges Vorstandsmitglied. Gründungsgedanke und -impuls war der Wunsch, kritische Stimmen aus allen mit Frauengesundheit befassten Berufsgruppen und der Frauengesundheitsforschung zu bündeln, um gemeinsam frauenfeindliche Vorgehensweisen in Medizin, Psychotherapie und Gesellschaft zu benennen und zu bekämpfen. In Zusammenarbeit mit dem AKF gründete Barbara Ehret das IZFG (Internationales Zentrum für Frauengesundheit) in Bad Salzuflen im Rahmen der Expo 2000. Sie ist Buchautorin und in beschränktem Ausmaß noch immer als Gynäkologin (Zweitmeinungssprechstunde) tätig. Sie verfolgt auch im Teilruhestand mit großem Interesse den modernen Feminismus, Entwicklungen in der Frauengesundheitsszene und die wechselnden und stets aktuellen Inhalte der Arbeit des AKF.
Erika Feyerabend
ist Sozialwissenschaftlerin, arbeitet als freie Journalistin und Dozentin an den Hochschulen Bochum und Düsseldorf. Sie beschäftigt sich seit Jahren im biopolitisch ausgerichteten Verein “BioSkop – Forum zur Beobachtung der Biowissenschaften” mit Problemen der Körperpolitik. Im Vorstand und Beirat der Hospizvereinigung Omega e.V. hat sie die Fragen moderner “Sterbegestaltung” und die gesellschaftlichen Bedingungen der Sorgearbeit im Blick. Sie ist seit Jahren im AKF e. V. engagiert.
Margit Glasow
arbeitet seit vielen Jahren als freie Journalistin im Printbereich und schreibt vor allem für Fachmagazine – da sie selbst mit einer Behinderung lebt – insbesondere zu den Themen Inklusion, Behinderung und Gesundheit. Darüber hinaus moderiert sie auf verschiedenen Veranstaltungen und seit einiger Zeit sowohl eine Radiosendung und seit Beginn des Jahres die TV-Sendung “Du hast das Wort” – beides auf dem offenen Kanal Alex Berlin.
Dr. Viola Hellmann
ist Fachärztin für Frauenheilkunde und Geburtshilfe. Sie studierte in Leipzig und praktizierte in Dresden mit der Zusatzbezeichnung „Psychotherapie“. Seit 2016 ist Viola Hellmann wiederholt in Nepal, um dort medizinische Hilfsprojekte zu unterstützen. Die Dresdener Frauenärztin ist seit 1995 Mitglied im AKF und konnte so als eine der ersten eine ostdeutsche Perspektive in den AKF bringen.
Dr. Antje Huster-Sinemillioglu
ist Fachärztin für Gynäkologie und Geburtshilfe und seit 25 Jahren als niedergelassene Ärztin in eigener Praxis in Dortmund tätig. Aufgrund ihrer Türkischkenntnisse hat sie insbesondere Erfahrung in der Arbeit mit türkischsprachigen Frauen. Sie ist frauen-gesundheitspolitisch engagiert im Arbeitskreis Frauengesundheit in Medizin, Psychotherapie und Gesellschaft e.V. (AKF) und dort seit 2011 Vorstandsmitglied.
Maria Krieger
ist Sozialpädagogin und Psychotherapeutin. Sie war in der Frauenberatung bei gynäkologischen Problemen tätig und hatte eine eigene frauenorientierte Praxis für Psychotherapie in Horneburg. Maria Krieger setzte sich maßgeblich für die Stärkung von Selbsthilfe und Beratung bei gynäkologischen Problemen ein. Sie engagierte sich im Hamburger „Arbeitskreis Frauenselbsthilfe bei gynäkologischen Problemen“ und gab z.B. die Broschüren „Wie notwendig ist eine Entfernung Ihrer Gebärmutter oder Ihrer Eierstöcke?“, „Was hilft Frauen nach einer gynäkologischen Operation?“ und „Sexualität nach gynäkologischen Operationen“ heraus. Gemeinsam mit Barbara Ehret, Ingrid Olbricht und Claudia Czerwinski war Maria Krieger Impulsgeberin für die Gründung des AKF“.
Download: Maria Krieger (1931-2019) – Impulsgeberin und Mitfrau im Gründungsvorstand (pdf)
Cony Lohmeier
ist Diplompsychologin, klinische Psychologin (BDP), Supervisorin und Coach (DGSv) und war fünf Jahre als Gewerkschaftssekretärin im Ressort Jugend und Frauen tätig. 29 Jahre war sie bei der Stadt München beschäftigt, u.a. fünf Jahre für das WHO-Projekt „Gesunde Städte“. Mitwirkung am Aufbau einer Abteilung Gesundheitsförderung und Prävention im 1989 gebildeten Gesundheitsreferat; 24 Jahre Mitarbeiterin der Gleichstellungsstelle für Frauen, u.a. für die Arbeitsbereiche Frauengesundheit und Gewalt gegen Frauen, Mädchen und Jungen; seit vielen Jahren tätig als Supervisorin und Coach.
Prof. Dr. Ingrid Mühlhauser
ist seit November 2017 Vorsitzende des AKF. Medizinstudium an der Universität Wien, etwa 20 Jahre lang tätig als Ärztin und wissenschaftliche Mitarbeiterin an den Universitäten Wien und Düsseldorf (Klinik für Stoffwechselkrankheiten und Ernährung. WHO Collaborating Centre for Diabetes), Habilitation und Venia legendi für Innere Medizin mit Schwerpunkt Gesundheitserziehung; Fachärztin für Innere Medizin, Diabetologie, Endokrinologie; seit 1996 Universitätsprofessur für Gesundheit, Universität Hamburg; bis 2016 Studienkoordinatorin für die Fachrichtung Gesundheit für das Lehramt an der Oberstufe – Berufliche Schulen (Gesundheitsfachberufe). Vorstandsmitglied des Deutschen Netzwerks Evidenzbasierte Medizin e.V. (DNEbM), von 2015 bis 2017 Vorsitzende, Sprecherin des Fachbereichs Patienteninformation und -Beteiligung.
Dr. Eva Schindele
studierte Sozialwissenschaften und Psychologie. Sie arbeitet als freie (Wissenschafts-)Journalistin und Autorin und hat Sachbücher geschrieben: u.a. Gläserne Gebär-Mütter und das 1993 viel diskutierte Buch „Pfusch an der Frau – krankmachende Normen, überflüssige Operationen und lukrative Geschäfte“ veröffentlicht sowie Essays zur Frauengesundheit und Medizinethik geschrieben. Sie entwickelte evidenzbasierte Patientinneninformationen zum Beispiel zum Brustkrebs-Zervixscreening oder zur Geburt. Eva Schindele engagiert sich seit Jahrzehnten in der Frauengesundheitsbewegung. Sie lebt in Bremen und hat zwei erwachsene Kinder.
Isabel Schindele
lebt und arbeitet im Ruhrgebiet und Bremen. Sie ist Sozialpädagogin und Kulturpsychologin. Sie arbeitete u. a. in der Projektentwicklung der Jugendhilfe sowie in der sozialpädagogischen Begleitung minderjähriger Mütter. Auf wissenschaftlicher Ebene beschäftigt sie sich mit religiösen Minderheiten sowie dem interreligiösen Dialog.
Prof. Dr. Ingrid Schneider
ist Politologin und arbeitet seit 2017 an der Universität Hamburg im Arbeitsbereich “Ethik in der Informationstechnologie” des Fachbereichs Informatik. Davor war sie fünfzehn Jahre wissenschaftliche Mitarbeiterin in der Forschungsgruppe Medizin/Neurowissenschaften des Forschungsschwerpunktes Biotechnologie, Gesellschaft und Umwelt (BIOGUM) der Universität Hamburg. Ingrid Schneider war auch Sachverständiges Mitglied der Enquete-Kommission „Recht und Ethik der modernen Medizin“ des Deutschen Bundestages und hat sich seit über zwanzig Jahren in der feministischen Bewegung zu Gesundheit und Körperpolitik sowie in der universitären Technikfolgenabschätzung engagiert.
Dr. habil. Viola Schubert-Lehnhardt
arbeitet als freiberufliche Dozentin und Autorin zu Fragen von Frauen- und Geschlechterforschung, Gesundheitspolitik und medizinischer Ethik, promovierte 1983 und habilitierte 1988 an der Martin-Luther-Universität Halle. Sie ist Herausgeberin und Autorin zahlreicher Bücher zu gesundheitspolitischen Themen. Sie ist Vizepräsidentin der Humanistischen Akademie Deutschlands e. V. und Sprecherin der deutschen Mitglieder von „Feminist Association of Bioethics“.
Dr. Silke Schwarz
ist seit November 2017 stellvertretende Vorsitzende des AKF und psychologische Psychotherapeutin für Erwachsene (Approbation voraussichtl. Sept. 18) und befindet sich in einer Weiterbildung zur Kinder- und Jugendtherapeutin. Nach fünfjähriger psychologischer Tätigkeit in einem Berliner Frauenhaus arbeitet sie an der Verbesserung der Gesundheitsversorgung für gewaltbetroffene Frauen mit komplexen Traumafolgestörungen und ihren Kindern im Land Berlin (S.I.G.N.A.L. e.V.).
Dr. Eva Waldschütz
arbeitet nun seit mehr als 30 Jahren als Frauenärztin, davon 13 Jahre in der Klinik und seit 2000 niedergelassen in einer Gemeinschaftspraxis. Anfang der 90-er Jahre war sie Frauenbeauftragte der wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen an der GHS Essen. Zusatzbezeichnungen/Weiterbildungen: „Psychotherapie“, „spezielle Geburtshilfe und Perinatalmedizin“, Fachkunde „suchtmedizinische Grundversorgung“, „medikamentöse Tumortherapie”. Ausbildung in Haptonomie, Psychoonkologie und Sexualmedizin. Dem AKF ist sie bereits 1994 beigetreten, ohne den sie sich ihr gynäkologisches Arbeiten gar nicht vorstellen möchte. Seit 2009 ist sie ehrenamtlich im Vorstand der pro faamilia NRW.
Fotogalerie
Das Themencafé im Rahmen der 25. AKF-Jahrestagung wurde gefördert von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) im Auftrag des Bundesministeriums für Gesundheit.
Die 25. AKF-Jahrestagung wurde gefördert durch das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ).
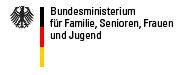
Veröffentlicht am: 15. August 2018 / Aktualisiert am: 19. Januar 2022 / 2018, Jahrestagungen